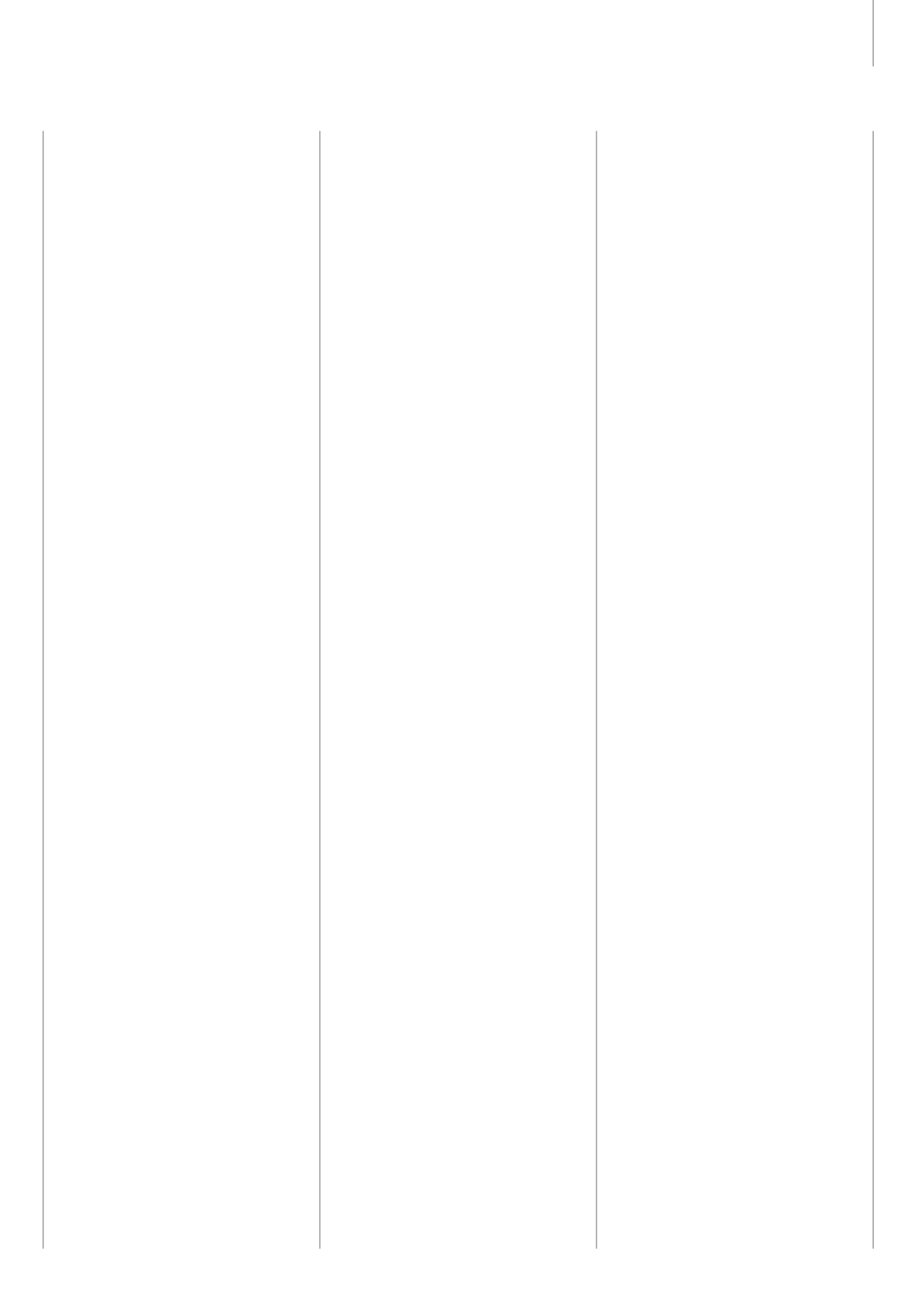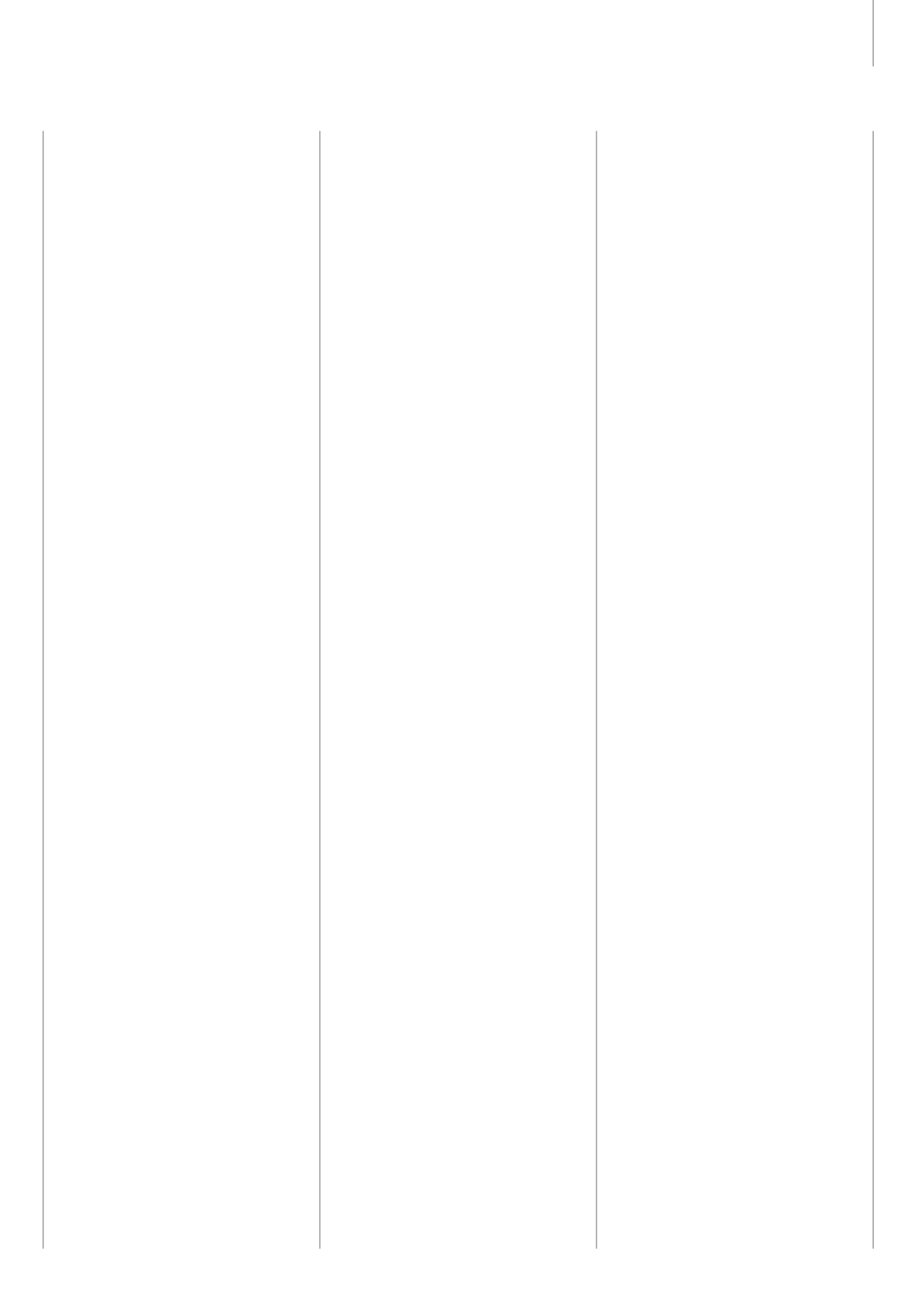
7
(Lösung) darstellen sollten, fand Harteck
eine geometrisch optimierte, getrennte
Anhäufung beider Massen zweckmäßiger.
Uranoxid und Trockeneis wurden in eine
geeignete Holzkiste (2mX2mX2m) an der
Außenwand des Institutsgebäudes (wegen
der Giftigkeit des CO
2
-Gases) gefüllt und
die Neutronenzahl gemessen. Die erwarte-
te Vermehrung um 25 %, die eine Ketten-
reaktion ermöglicht hätte, fand nicht statt;
d.h. der Reaktor wurde nicht kritisch. Die
sich hieraus ergebende Korrektur hin-
sichtlich der Bremslänge der Neutronen
sowie die Realisierung einer Schichten-
Anordnung von Brennstoff und Moderator
waren die wichtigsten Erkenntnisse dieses
Versuchs.
Neben dem Reaktorbau wurden auch an-
dere Untersuchungen im Rahmen des Ge-
samtprojekts durchgeführt, insbesondere
Uran-Isotopen-Trenn- bzw. Anreicherungs-
versuche
235
U/
238
U. Für die Isotopentren-
nung wurden zunächst Versuche mit dem
Clusius-Dickelschen Trennrohr vorgenom-
men. Mehr Effizienz erwartete man sich
bei Verwendung mechanisch beweglicher
Flächen. Durch einen Besuch von
Hans
Martin
(1908-1979, 1933 in Heidelberg
promoviert, 1933-36 Assistent in Karls-
ruhe, 1941 Habilitation in Kiel, 1947 apl.
Professor, 1949 a.o. Professor und Direktor
des Physikalisch-Chemischen Instituts der
Universität Kiel, 1957 ord. Professor, 1974
emeritiert) im Sommer 1941 am Hambur-
ger Institut wurden Harteck und Groth auf
dessen Ultrazentrifugen aufmerksam. Eine
entsprechende Zentrifuge ließ Harteck
von der Firma Anschütz (Kreiselkompasse)
bauen, wichtigster Beteiligter von dort
war der Ingenieur Dr. Konrad Beyerle. Die
Arbeiten (auch mit Beteiligung von Suhr)
wurden nach der schweren Bombardie-
rung Hamburgs nach Freiburg und von dort
schließlich in einen Industriebetrieb in Celle
ausgelagert. Nach dem Kriege wurden sie
von Groth in Bonn und in Hamburg von
dem Assistenten
Hermann Gerhard Hertz
fortgeführt (geb. 1922 in Hamburg, Pro-
motion 1952 bei Paul Harteck, 1952-1959
Wiss. Assistent am Hamburger Institut für
Physikalische Chemie, 1960-64 Assistent
am Institut für Physikalische Chemie der
Universität Münster bei Ewald Wicke, dort
1960 Habilitation, 1964 a.o. Professor, 1965
Berufung auf die ordentliche Professur
für Physikalische Chemie der Technischen
Hochschule (später: Techn. Universität)
Karlsruhe, 1990 emeritiert, gest. 1999 in
Karlsruhe).
Wegen der geringen Aussicht, in abseh-
barer Zeit die Uran-Isotopen-Anreicherung
in technischem Umfang realisieren
zu können, wurde im Hinblick auf die
„Uranmaschine“ die Anwendung von
Natur-Uran(oxid) und dann aber schwerem
Wasser als Moderator ins Auge gefasst. Die
Herstellung von schweremWasser durch
fortgesetzte Elektrolyse (wobei kathodisch
die Entwicklung von leichtemWasserstoff
bevorzugt ist, sodass sich Deuterium in der
wässrigen Phase anreichert) erfordert hohe
Energiemengen. Sie wurde z.B. in Norwe-
gen von der Firma Norsk Hydro durchge-
führt, und nach der im Laufe des Krieges
erfolgten Besetzung Norwegens war hier
prinzipiell ein Zugriff möglich. Ein von
Harteck und Suess gefundenes Verfahren
erst brachte die hinreichende Effizienz.
Dabei wird das nach fortgesetzter Elektro-
lyse auch angereicherte Kathodengas nicht
verbrannt, sondern durch Wasser geleitet;
der imWasser verbleibende molekulare
Wasserstoff enthält dann im Gleichgewicht
dreimal so viel Deuterium wie derjenige in
der Gasphase. Aber auch die Norsk Hydro
wurde 1943 schwer durch Bombardierung
geschädigt, sodass auch diese Richtung
aufgegeben werden musste.
Andere Arbeiten der Harteck-Mitarbeiter
betrafen verschiedene Aspekte der Kern-
chemie (Altersbestimmung mit
40
K, durch
Kernreaktionen ausgelöste chemische
Prozesse bei Brom, Alter und Entstehung
der Elemente, Planeten- und Meteoriten-
Entstehung, alles Suess), „magische
Nucleonenzahl“ (Suess mit Jensen) und
eine Diffusions-Nebelkammer (Hertz). Über
die Ad-/Desorption der Wasserstoff-Isotope
arbeitete
G. Arthur Melkonian
(geb. 1916 in
Rostow/Don, Chemiestudium in Hamburg,
1941 Promotion bei Heinz Ohle in Berlin,
1942-44 Mitarbeiter am Institut für Che-
mische Technologie der Tech. Hochschule
Braunschweig, 1944-1958 Mitarbeiter
am Institut für Physikalische Chemie der
Universität Hamburg, 1958-81 leitende
Funktionen bei der GKSS/Ges. f. Kernener-
gieverwertg. in Schiffbau u. Schiffahrt,
Lehrbeauftragter 1968-81 Univ. Hamburg
und 1974-81 Univ. Münster, 1980 Akadem.
Bezeichng. Professor durch den Senat der
Freien u. Hansestadt Hamburg, gest. 1981
in Hamburg).
Als Harteck ab 1951 zunächst zeitweise
und 1952 schließlich endgültig in die USA
auswanderte, wurde die Vertretung der
Professur zunächst
Günther Briegleb
(geb.
1905 in Wilhelmshaven, Promotion 1929
bei Gerhard Preuner in Kiel, 1929-1936
Assistent bei Georg Bredig bzw. Ludwig
Ebert in Karlsruhe, dort 1936 Habilitation,
1937-45 a.o. Professor für Physikalische
Chemie, Universität Würzburg, 1945-51
Industrietätigkeit, 1951/53 Vertretungspro-
fessur in Hamburg, 1953-73 ord. Profes-
sor für Physikalische Chemie Universität
Würzburg, gest. 1991) und danach
Ludwig
Holleck
übertragen (geb. 1904 in Wien,
1930 Promotion bei Wolf Johannes Müller
in Wien, 1934/35 Mitarbeiter an der
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt
in Berlin (Isotopentrennung), 1935-37
Assistent bei Walter Noddack, Institut für
Physikalische Chemie Universität Freiburg,
1937 Habilitation in Freiburg, 1937-41
Privatdozent in Freiburg, 1941-43 apl. Pro-
fessor und 1941-45 a.o. Professor und Leiter
der Elektrochemie-Abteilung des Instituts
für Physikalische Chemie der „Reichsuni-
versität Straßburg“, 1945-49 freiberuflicher
Autor, 1949-55 apl. Professor für Physikali-
sche Chemie Universität Freiburg, 1952/54
Lehrstuhlvertretung in Hamburg, 1955-61
apl. Professor am Institut für Physikalische
Chemie Universität Hamburg, 1961-72
ord. Professor für Chemie, Institut für
Chemie der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Bamberg, 1965/67 Rektor der
Hochschule, gestorben 1976 in Konstanz).
Diese Vakanz zwischen Harteck und seinem
Nachfolger Wicke war eine sehr ruhige
Periode für das Institut. Holleck brachte aus
Freiburg zwei Doktoranden mit (Hermann
Schmidt und Lothar Plümer), dazu gesellten
sich Knauers zwei Doktoranden (Walter
Kühl und Hans Gienapp), aus der Harteck-
Zeit verblieb noch Gerhard Hertz, 1954 kam
noch zunächst als Diplomand, danach als
Doktorand Bertel Kastening (siehe später)
zur Holleck-Gruppe. Zusammen mit der
Sekretärin Frau Elisabeth Holstein und
dem Feinmechanikmeister Karl Reiser (ca.
1931 von Stern ans Institut geholt und bei
allen Direktoren bis Knappwost in den 60er
Jahren als ideenreicher, zuverlässiger Mitar-
beiter geschätzt) ergab sich eine mittägli-
che Teerunde als Institution. Als Hartecks
Nachfolger wurde zumWintersemester
1954/55 Ewald Wicke berufen.
Ewald Wicke
wurde am 17. August
1914 in Wuppertal-Elberfeld geboren. Er
studierte 1933-38 in Köln und Göttingen
Chemie, Physik und Physikalische Chemie
und promovierte 1938 bei Arnold Eucken in
Göttingen. 1938-44 Assistent bei Eucken.
1944 habilitierte er sich und war Privat-