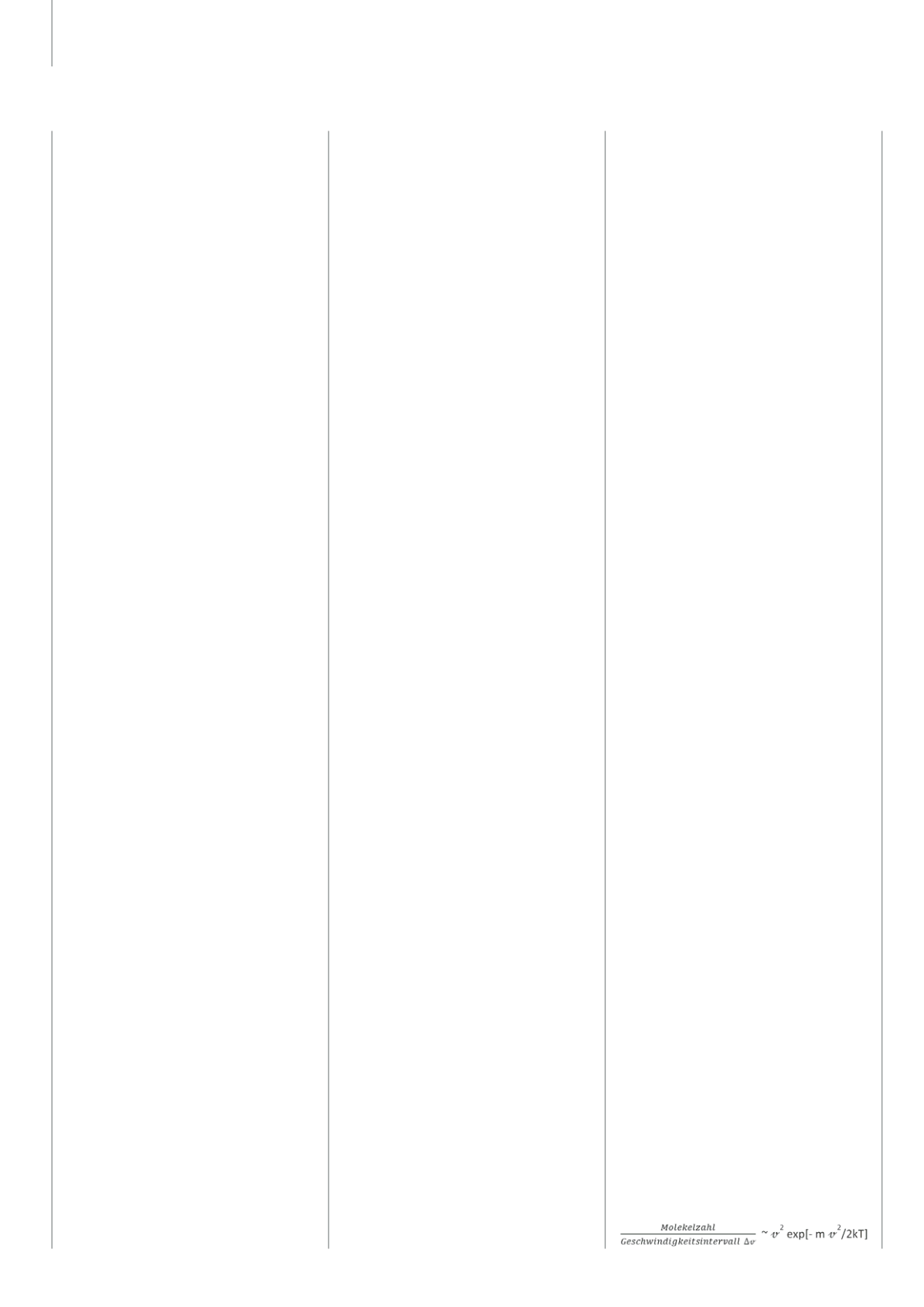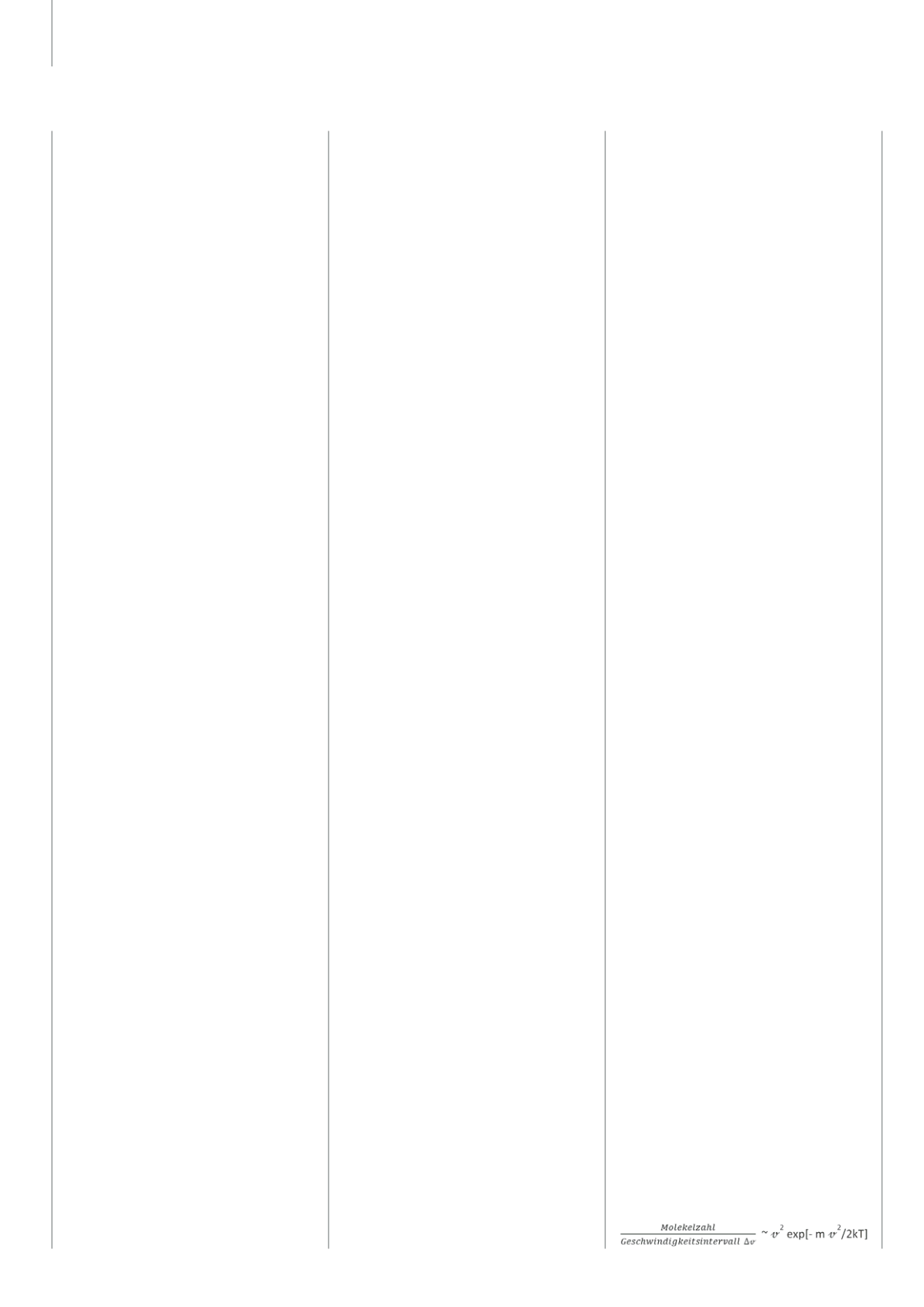
46
1913 reicht er die 8(!!)-seitige Arbeit als
Habilitationsschrift ein und erhält 1913 die
Venia legendi
der ETH Zürich für das Fach
physikalische Chemie. Im August 1913 wird
er Privatdozent für physikalische Chemie an
der ETH Zürich.
Zweite Theoretische Phase:
Flucht in die Selbständigkeit
– Frankfurt und Wehrdienst – 1914-19
Privatdozent in Frankfurt
Der Wunsch, Zürich zu verlassen, wurde
vermutlich durch den Weggang seines
Lehrers Einstein ausgelöst, der 1914 zum
Direktor des KWI für Physik nach Berlin
berufen wurde.
Im November 1914 beantragte er von Ber-
lin aus seine Umhabilitation zur Zulassung
als Privatdozent für theoretische Physik an
der Universität Frankfurt amMain mit der
gleichen bereits oben erwähnten Habilita-
tionsschrift und dem Zitieren von 3 wei-
teren Publikationen sowie "noch einigen
kleineren Artikeln mehr polemischer oder
literarischer Art".
Nach seiner Umhabilitation wurde er
Privatdozent für Theoretische Physik an der
Universität Frankfurt. Dort traf er auf ein
Umfeld, welches bestimmt war durch den
Theoretischen Physiker Max von Laue, der
im August 1914 von Zürich nach Frankfurt
gewechselt hatte, und Richard Wachsmuth,
dem Ordinarius für Experimentalphysik.
Nach Ausbruch des Weltkriegs meldet sich
Stern bei der Armee und wurde zunächst
als Gefreiter, später als Unteroffizier, mit
technischen Aufgaben betraut.
Im Jahre 1916 publizierte er 2 Arbeiten,
erschienen in den Annalen der Physik:
Die
Entropie fester Lösungen
und
Über eine Me-
thode zur Berechnung der Entropie von Sys-
temen elastisch gekoppelter Massenpunkte,
entstanden in Lomcza/Polen, im Nordosten
Polens nahe der russischen Grenze, ca. 75
km westlich von Bialystock, wo er seit Ende
1915 als Wetterbeobachter stationiert war.
Da er viel freie Zeit hatte, nutzte er diese,
um sich mit dem Problem der Energie-
berechnung eines Systems gekoppelter
Massenpunkte zu beschäftigen.
Im Felde und bei Walther Nernst in Berlin
1919 war er zur Durchführung kriegswich-
tiger Forschung an das Institut für Physi-
kalische Chemie der Friedrich-Wilhelm-
Universität Berlin abkommandiert, dessen
Leiter Walther Nernst war.
Hier traf er mit Max Volmer und James
Franck zusammen. Volmer hat später er-
zählt, dass Stern ihm regelmäßig Nachhilfe-
stunden in Thermodynamik gegeben habe,
während er selbst Apparate konstruierte
und glastechnische Arbeiten übernahm.
Unmittelbares Ergebnis dieser Zusammen-
arbeit waren 3 gemeinsame Veröffentli-
chungen:
•
Über die Abklingungszeit der Fluoreszenz;
•
Sind die Abweichungen der Atomgewichte
von der Ganzzahligkeit durch Isotopie
erklärbar?
•
Bemerkungen zum photochemischen
Äquivalenzgesetz vom Standpunkt der
Bohr-Einsteinschen Auffassung der Licht-
absorption.
In der ersten gelang ihnen erstmals die Be-
rechnung von Abklingzeit und der Lebens-
dauer im angeregten Zustand und eine
umfassende quantitative Beschreibung
photochemischer Prozesse durch die
Stern-Volmer-Gleichung.
In der zweiten Arbeit sind Stern und
Volmer der Überlegung nachgegangen, ob
Wasserstoff mit der Atommasse 1,008 ein
Gemisch zweier Isotope mit den Atommas-
sen 1 und 2 oder ob die Abweichung auf
das Massenäquivalent der Bindungsenergie
zurückzuführen sei. Man darf nicht verges-
sen, dass zu dieser Zeit die Kerne nur aus
Protonen und Elektronen zusammenge-
setzt betrachtet wurden und das Neutron
sowie das Isotop Deuterium erst 1932
entdeckt wurden.
Beide lernten während ihrer Arbeiten
Nernsts Assistentin Dr. Lotte Pusch kennen.
Zwischen Lotte Pusch, Otto Stern und Max
Volmer entwickelte sich eine enge Freund-
schaft. Zum Leidwesen Otto Sterns gab
Lotte Pusch demWerben Volmers nach und
beide wurden am 15. März 1920 getraut.
Stern hat gegen Ende seiner Berliner Zeit
im November 1918 eine Arbeit
Zusam-
menfassender Bericht über die Moleku-
lartheorie des Dampfdrucks fester Stoffe
und ihre Bedeutung für die Berechnung
chemischer Konstanten
fertiggestellt, in der
er sich nochmals mit den bereits in seiner
Habilitationsschrift behandeltenThemen
auseinandersetzt.
Erste Experimentelle Phase: Privatdozent
in Frankfurt und Extraordinarius in Rostock,
1919-22
Assistent bei Max Born
Nach seiner Entlassung vomMilitär kehrte
Stern nach Frankfurt zurück und setzte
zunächst seine Arbeit an theoretischen
Problemen fort, von nun an mit Max Born,
zu dessen Institut für theoretische Physik
seine Stelle gehörte.
1919 wurde Stern Titularprofessor und
firmierte fortan bei den Physikalischen
Lehrveranstaltungen als Privatdozent Prof.
Dr. O. Stern. Aus dieser Zusammenarbeit
mit Max Born entsprang die Arbeit
Über die
Oberflächenenergie der Kristalle und ihren
Einfluss auf die Kristallgestalt
.
1920 folgte eine weitere theoretische
Arbeit von Stern
Zur Molekulartheorie des
Paramagnetismus fester Salze,
in der er sich
erstmalig mit demmagnetischen Moment
befasst, was ihn später nicht mehr loslas-
sen sollte.
In diese Zeit fällt Sterns Interesse an einer
neuen Technik, der Atom- oder Moleku-
larstrahl-Methode, für deren erfolgreiche
Verwendung er das richtige Gespür hatte.
Die Anfänge dieser Technik gehen auf
Louis Dunoyer zurück, der 1911 in
Comptes
Rendus
eine Abhandlung
"Sur la théorie
cinétique de gaz et la réalisation d'un
rayonnement matériel d'origine thermique"
veröffentlichte, nachdem ihm im Jahr zuvor
die Herstellung von Na-Atomstrahlen ge-
lungen war. Bei diesemVerfahren wird die
zu untersuchende Substanz (z.B. in einem
Ofen) in den Gaszustand überführt und
durch Blenden und Evakuieren ausgedünnt,
so dass es zu einer strahlenartigen Ausbrei-
tung der Teilchen kommt, die sich auf diese
Weise einzeln spektroskopisch oder magne-
tisch untersuchen lassen. Gewissermaßen
zur Bewährung sollte sie 9 Jahre später bei
der Ermittlung der Molekülgeschwindigkeit
verwendet werden.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich
das Lehrgebäude der kinetischen Gasthe-
orie entwickelt, deren Begründer Maxwell,
Clausius und Boltzmann waren. Maxwell
hat 1859 das Geschwindigkeitsverteilungs-
gesetz intuitiv gefunden und 1867 verbes-
sert hergeleitet. Hiernach ist die